
Artikel von Michael Reink, geschäftsführendes Vorstandsmitglied urbanicom e.V.und Bereichsleiter für Standort- und Verkehrspolitik beim Handelsverband Deutschland, erschienen in Immobilien & Finanzierung, Ausgabe vom 02.01.2026
Vielen Innenstädten geht es nicht gut. Die Diagnose reicht von Frequenzverlusten über fehlende Funktionsmischung und strukturellen Leerständen bis hin fehlenden Investitionen durch klamme kommunale Haushalte. Hinzukommt eine Stadtbilddebatte, die bisher wenig Erbauliches oder gar eine Zielrichtung zustande gebracht hat. In Anbetracht der Tatsache, dass die Innenstädte die wichtigsten Handelsstandorte sind, ist die Zustandsbeschreibung nebst fehlender Lösungsansätze für den Handel alles andere als gut.
Doch schauen wir uns die Diagnose etwas genau an, um möglicherweise daraus die zukunftsweisenden Schritte abzuleiten. Der Handel leidet seit Corona unter einer dauerhaften Konsumzurückhaltung, die zunächst veranlasst von den Lockdowns, vom Angriffskrieg in der Ukraine um ein Vielfaches übertroffen wurde. Zudem sind deutliche Ausschläge durch weitere internationale Krisen z.B. in Gaza abzulesen. Die Unsicherheit der Märkte, die Unsicherheit im politischen Agieren ehemaliger Freunde, die Unsicherheiten durch die Digitalisierung etc. führen dazu, dass die Verbraucher das Geld nicht für den Konsum ausgeben. Interessant ist dabei die hohe Komponente internationaler Ereignisse, die von der Bundesregierung nur sehr bedingt beeinflussbar sind.
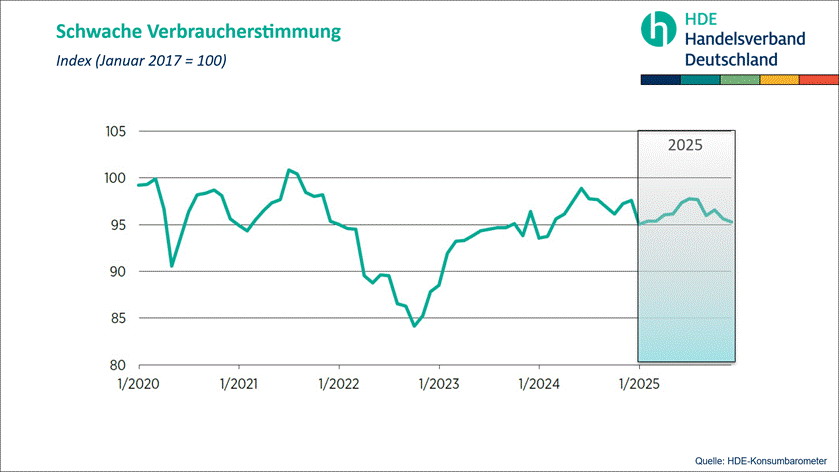
Im Zuge der schlechten Konsumlaune haben die Umsätze des Handels preisbereinigt in den letzten Jahren quasi eine Seitwärtsbewegung gemacht. Der Onlinehandel hat etwas dazugewonnen, wobei die Wachstumsraten insgesamt schwächer geworden sind. Wenn die Sondereffekte der Coronazeit herausgerechnet werden, wird jedoch erkennbar, dass das Wachstum des Online-Handels weiterhin kontinuierlich zunimmt. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Der Handel weiß daher, dass Investitionen in den Online-Handel, in Social-Media-Aktivitäten, in KI bzw. insgesamt in die Digitalisierung notwendig sind. Jedoch sind die Möglichkeiten von Investitionen derzeit begrenzt, da etliche Unternehmen während der Corona-Zeit auf Rücklagen zurückgegriffen haben. Somit wirken die für den Einzelhandel verhängten Lockdowns bis heute fort.
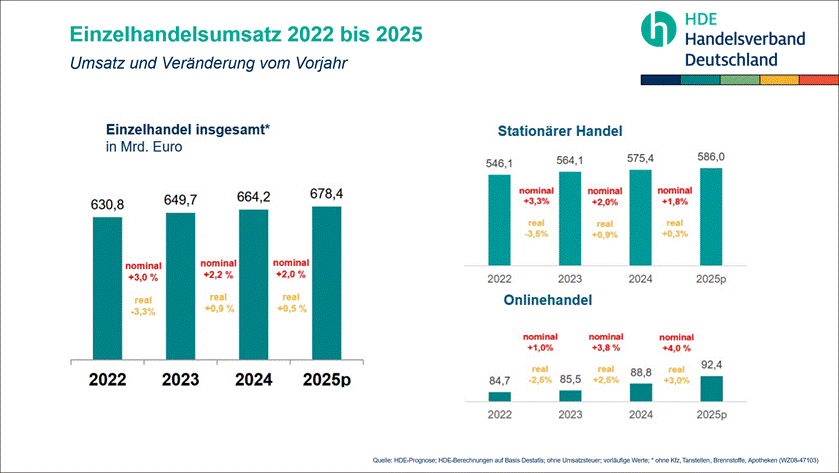

Zudem muss sich jedes Unternehmen die ehrliche Frage stellen, inwiefern nicht nur Umsatzzuwächse, sondern auch echte Gewinne im Zuge von Digitalisierungsmaßnahmen zu erzielen sind. So gaben bei einer Umfrage des Fachverbandes „Handelsverband Textil, Schuhe, Lederwaren (BTE)“ 60 Prozent der Händler an, keine Gewinne durch den Online-Handel zu generieren. Somit ist der Online-Handel für einen Großteil der stationären Unternehmen eine Serviceleistungen gegenüber den Kunden und im Wirtschaftsplan eher auf der Kostenseite zu verbuchen. Da der wesentliche Umsatz bei den wenigen „Gate-Keepern“ zu finden ist – vor allem die großen Online-Plattformen – bieten viele Händler ihre Produkte dort an. Jedoch ist es bei Produktsuche der Kunden nur möglich, ca. 30 Angebote der Unternehmen auf der ersten Seite der Suchmaschinen oder Online-Plattformen abzubilden. Diese Platzierung ist entscheidend für den erfolgreichen Verkauf der Produkte und lässt sich erkaufen. Die Konsequenz ist jedoch, dass von allen bundeweiten Online-Anbietern nur sehr wenige tatsächlich für den Kunden sichtbar und somit relevant sind. Es gibt daher ein gewisses „Highlander-Prinzip“ in der Systematik des Online-Handels. Im Ergebnis muss der Einzelhandel dem Kundenwunsch nach mehr digitalen Angeboten nachkommen, auch wenn dies in vielen Fällen nur ein kostspieliges Serviceangebot sein wird.
Gemäß der Befragungsergebnisse der Händler vor Ort, haben die Kundenfrequenzen vielfach nachgelassen. Dies wird teilweise durch automatisierte Frequenzmessungen bestätigt, wobei einige Innenstädte das normale Vor-Corona-Niveau wieder erreicht bzw. sogar übertroffen haben. Dennoch bleibt, dass die Verbindung von Konsumzurückhaltung und Frequenzverlusten zu Geschäftsaufgaben geführt haben. Dies ist kein neues Phänomen, da seit Jahren ein Abschmelzungsprozess vor allem beim kleinen und nicht filialisierten Handel festzustellen ist. Diese Geschäftsverluste konnten jedoch oft durch Nachvermietungen von Finalunternehmen oder Nutzungsänderungen (z.B. Gastronomie) kompensiert werden. In den Jahren 2020 bis 2022 hatten sich die Geschäftsaufgaben jedoch verdoppelt, so dass struktureller Leerstand entstanden ist, der in vielen Innenstädte bis heute nicht abgebaut werden konnte. Dabei ist der Handel eine sehr dynamische Branche, so dass den Geschäftsaufgaben gemäß des KFW-Gründungsmonitors jährlich rund 125.000 Neugründungen gegenüberstehen.
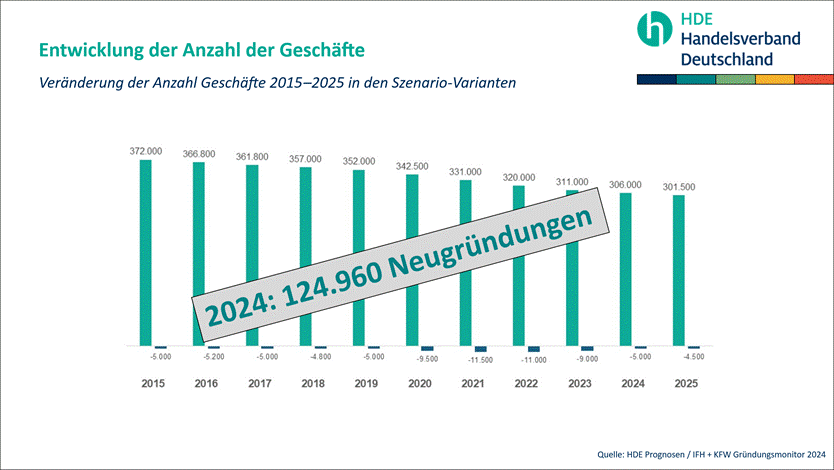
Daher gilt es, diese Gründerwelle weiter zu unterstützen, auszubauen und den Gründern bzw. Startups Hilfestellungen anzubieten. Die Idee dafür ist alt und längst bewährt: Gründerzentren. Diese müssen jedoch gezielt auf die Gründung in den Innenstädten als „Innerstädtische Gründerzentren“ weitergedacht werden, wie dies bereits in einigen Städten umgesetzt wird. Hierbei fungieren die Kommunen als Zwischenmieter, geben Zuschüsse z.B. für die Miete, die Ladengestaltung sowie den Wareneinkauf und bieten Schulungen nebst weiterer Unterstützung an. Dies bietet die Möglichkeit die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der kommunalen Gründerzentren in die Innenstädte zu adaptieren. Gleichzeitig können Existenzgründer im Handel unterstützt, Arbeitsplätze geschaffen, der Branchenmix und die Attraktivität erhöht sowie bestehende Leerstände abgebaut werden. Hierzu gibt es gute Beispiele aus Lohne oder Wittlich auf der vom Handelsverband Deutschland in Zusammenarbeit mit den Kommunalen Spitzenverbänden und der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing aufgebauten Best-Practice-Datenpool www.unsere-stadtimpulse.de .
Eine weitere Möglichkeit zur Vitalisierung der Innenstädte wird in einer Erhöhung der Multifunktionalität gesehen. Insbesondere die innerstädtische Verdichtung der Wohnbevölkerung gilt vielen als wirksamer Schlüssel. Dabei hat eine aktuelle Studie des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BBSR) festgestellt, dass die Nutzungsmischung in den Innenstädten seit jeher gegeben ist. Demnach sind 12 Prozent aller Erdgeschossnutzungen durch das „Wohnen“ belegt. Vielmehr gibt es in den Innenstädten Nutzungscluster des Einzelhandels, der Gastronomie der öffentlichen Verwaltung und teilweise der Kultur. Ab und zu ergeben sich räumliche Symbiosen, wobei beispielsweise der Einzelhandel vornehmlich in der Fußgängerzone zu finden ist. Die Ausstrahlungseffekte der „Hauptgeschäftslage“ sind jedoch derart groß, dass ganze Innenstädte mit der Güte und dem Angebot in der Hauptgeschäftslage gleichgesetzt werden („Wir gehen in die Stadt“). Dabei kann die Erhöhung der Wohnbevölkerung durchaus zu Konflikten in Form von neuen Gemengelagen führen. Die bisher im Verhältnis von Gewerbegebieten zu Wohngebieten bekannte „heranrückende Wohnbebauung“ kann zu Klagen der Wohnbevölkerung gegen dem ansässigen Gewerbe in den Innenstädten führen. In der Regel werden die Urteile zugunsten der Wohnbevölkerung getroffen, da der Schutz des einzelnen stärker gewichtet wird als das wirtschaftliche Interesse eines Unternehmens. In der Konsequenz könnte dies zu unerwünschten Verdrängungsprozessen führen. „Unerwünscht“ deshalb, da das Wohnen keinen Einzugsbereich hat und somit keine „hochrangig zentrale Funktion“ ist. Da das Wesen der Innenstädte jedoch die „Konzentration hochrangig zentraler Funktionen“ (Handel, Gastronomie, Kultur, öffentliche Verwaltung) ist, würde eine Verdrängung genau das Gegenteil einer Vitalisierung der Innenstädte bedeuten: Die Entwicklung hin zu Schlafstädten. Daher ist die Umnutzung von ehemaligen Handelsflächen zu Wohnungen vielfach eine zukunftsweisende Maßnahme. Dies hat aber städtebaulich mit Maß und Verstand zu geschehen. Zudem müssen die dadurch entstehenden Gemengelagen präventiv entschärft werden, indem die Lärmwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) praxisgerecht erhöht werden und der Messpunkt in die Wohnung verlagert wird. Bei dem bisher vorgegebenen Messpunkt außerhalb der Wohnung sind Schallschutzmaßnahmen an der Fassade oder den Fenstern wirkungslos, so das der passive Schallschutz in Deutschland bisher keine Option zur Entschärfung von Gemengelagen ist.
Eine Sonderform der Mischung von Einzelhandel und Wohnen ist das „Wohnen über dem Lebensmitteleinzelhandel“. Gemäß einer Hochschulstudie kann allein durch das Überbauen der „Flachmänner“ des Lebensmitteleinzelhandels ein großer Teil des Wohnraumbedarfs gedeckt werden. Soweit die Theorie. In der Praxis stellt man jedoch schnell fest, dass die bestehenden Gebäude allein statisch dafür überhaupt nicht ausgelegt sind. In erster Linie sind die Gebäude zur Schaffung zeitgemäßer Handelsstandorte mit entsprechender Verkaufsflächengröße und Filiallogistik errichtet worden. Neben den unzureichenden baulichen Anforderungen (Statik) bestehen auch vielfältige wirtschaftliche Anforderungen bei diesen Mixed-Use-Immobilien. Diese Immobilien kosten in der Regel das 5-10fache einer klassischen Handelsimmobilie und sind in der Planung, im Bau und Betrieb erheblich aufwändiger. Zu den Herausforderungen gehört der Schallschutz (Klimaanlagen, Müllpressen, Anlieferung, Lautsprecherdurchsagen, Einkaufswagen, Kundenverkehr etc.), Geruchsemissionen (z.B. durch Lüftungsgeräte und Fettascheider) und Lichtemissionen durch Beleuchtung der Wohnungen im Zuge des Kunden- und Lieferverkehrs. Daher wird das Wohnen über dem Lebensmitteleinzelhandel immer eine Nische bleiben, auch wenn unzählige Medienberichte etwas anderes suggerieren. Selbstverständlich plant, baut und betreibt der Lebensmitteleinzelhandel seit Jahren derartige Immobilien. Dennoch funktionieren diese Spezialimmobilien nur an ausgewählten Standorten und sind in keiner Weise geeignet, den Wohnungsfehlbestand abzumildern.
Sehr ermutigend ist im Hinblick auf die weitere Innenstadtentwicklung die Prägung der Bürger auf ihre Innenstädte. Der Einzelhandel ist nach Lage aller Studien nach wie vor der Hauptgrund für einen Innenstadtbesuch. Die Kombination von Einzelhandel und Gastronomie bildet das überwiegende Kopplungsveralten ab – und das generationenübergreifend. Insbesondere junge Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren kommen zu 92 Prozent gern in ihre Innenstadt. Da das Einkaufsverhalten über die Generationen mitgetragen wird, ist davon auszugehen, dass die Innenstädte auch in Zukunft die wichtigsten Orte des Konsums sein werden. Dennoch gilt es zu Handeln und die Angebote des Handel sowie die Innenstädten nach den Bedürfnissen auch der jungen Generationen anzupassen. Demnach entwickeln sich die Innenstädte immer mehr zu Orten in denen nicht nur konsumiert, sondern die Freizeit verbracht wird. Das erfordert eine andere Bespielung der Ladenflächen und Community-Building durch den Handel genauso, wie attraktive öffentliche Räume und eine durch die Kommunen kuratierte Funktionsmischung.
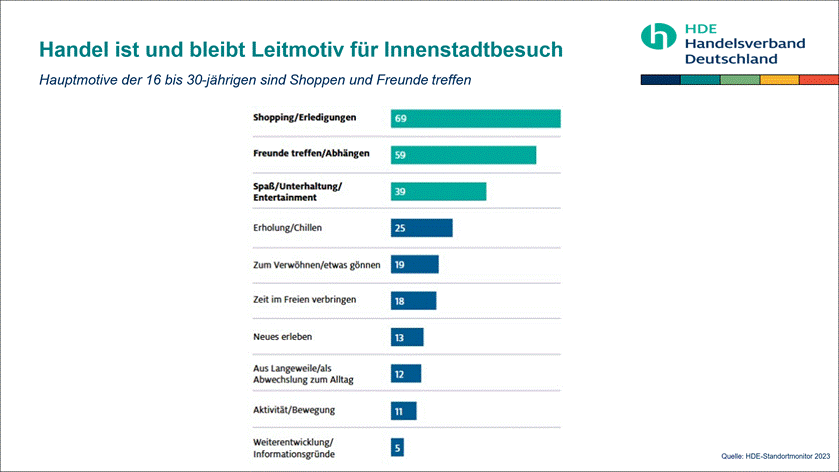
Es stellt sich die Frage, ob die Kommunen verstanden haben, dass sie sich nicht länger nur auf die guten Warenauslagen des Handels verlassen können, sondern selbst in der Pflicht sind, attraktive öffentliche Räume zu schaffen. Bei der einen oder anderen Kommune mag man Zweifel haben, da die letzten Investitionen offensichtlich in der 70er oder 80er Jahren getätigt worden sind. Die ostdeutschen Kommunen stehen gemäß einer Sonderauswertung der Deutschlandstudie Innenstadt 2024 in der Regel besser da, da die massive Förderung und die Sonderabschreibungsmöglichkeiten in den 90er zu erheblichen Investitionen geführt haben. Infolge des damals bereits bestehenden Leitbildes der multifunktionalen Innenstadt sind die ostdeutschen Innenstädte grundsätzlich auch dort besser aufgestellt. Der Brandbrief der Oberbürgermeister an den Bundeskanzler bezüglich der hohen kommunalen Verschuldung, des bestehenden Investitionsstaus und der Perspektive nur noch die Pflichtaufgaben erfüllen zu können, sollte Anlass zum Handeln sein. Denn eine attraktive Innenstadt gehört nicht zur Pflichtaufgabe der Kommune und bleibt dennoch der wichtigste Identifikationsstifter für die Bürger und Bürgerinnen. In Anbetracht der klammen kommunalen Haushalte muss zwangsläufig privates Kapital für die Innenstadtentwicklung mobilisiert werden. Die Blaupause kennen wir durch die Sonderabschreibungen für Investitionen in die ostdeutschen Innenstädte aus den 90er Jahren. Die Wirkung ist bewiesen. Daher muss es eine Sonderabschreibung für strukturschwache Innenstädte (Sonder-AfA-Innenstadt) im gesamten Bundesgebiet geben. Die damaligen Abschreibungsmöglichkeiten von 10 Prozent in 10 Jahren würden auch heute zu veränderten Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Investoren führen. Die zunächst für die Kommunen entstehenden Einnahmeverluste würden voraussichtlich zu erheblichen privaten Mehrinvestitionen führen und in der Gesamtbilanz die Vitalisierung der Innenstädte erst ermöglichen. Es ist demnach ein neuer Schulterschluss zwischen den Kommunen und dem Handel mit der Landes- und Bundespolitik von Nöten. Fragen des Mobilitätswandels und der Transformation zu klimaresilienten Innenstädten sind dabei noch gar nicht angesprochen und weisen auf die Größe der Herausforderungen hin.
Der Text ist erstmalig erschienen in Immobilien & Finanzierung, Ausgabe vom 02.01.2026
